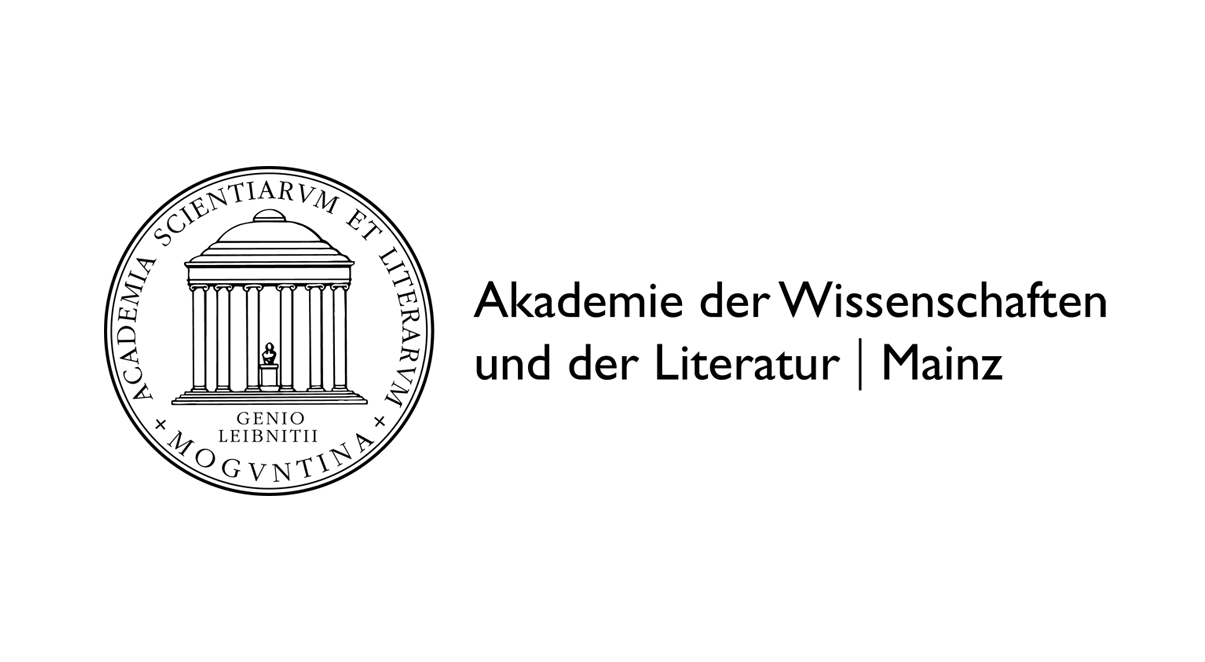Handschriftenbeschreibung 4212
Aufbewahrungsort | Inhalt | Kodikologie | Forschungsliteratur
Aufbewahrungsort
| Institution | Art | Umfang |
|---|---|---|
| Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 2848 | Codex | IV + 300 + II Blätter |
Inhalt
| Heinrich der Teichner: Gedichte (C), darin: B. IIIr-IVv = Register Bl. 41r-42r = Heinrich der Teichner: Von dem roten Mund Bl. 148v-149r = Heinrich der Teichner: Frauenehre Bl. 232r-233v = 'Das Almosen' (w3) Bl. 251v-252v = 'Das schlaue Gretlein' Iβ(W1) Bl. 262r = Heinrich der Teichner: Von rechter Liebe Bl. 271r-271v = Heinrich der Teichner: Von der Minne Bl. 271v-272v = Heinrich der Teichner: Klage einer Frau |
Kodikologie
| Beschreibstoff | Papier | ||
|---|---|---|---|
| Blattgröße | 293 x 220 mm | ||
| Schriftraum | 220 x 145 mm | ||
| Spaltenzahl | 1 (Bl. 300: 2) | ||
| Zeilenzahl | 33-36 (Bl. 300: 33) | ||
| Versgestaltung | Verse abgesetzt, oft zwei Verse auf einer Zeile | ||
| Besonderheiten | Bibliotheksprovenienz: Wien, Chorherrenstift St. Dorothea (Menhardt S. 455) | ||
| Entstehungszeit | 1469 (Bl. 1r) | ||
| Schreibsprache | bair. oder schwäb. Schreiber (Menhardt S. 455) | ||
| Schreibort | Melk (s. Erg. Hinweis) | ||
| Schreibernennung |
| ||
Forschungsliteratur
| Abbildungen | |
|---|---|
| Literatur (in Auswahl) |
|
| Archivbeschreibung | Heinrich Niewöhner (1923) |
| Ergänzender Hinweis | Nach der Lokalisierung des Einbandes nach Melk (Fingernagel/Simader mit Abb. von Missale-Fragmenten [Melk, um 1200] und Einbandstempeln) und der stilistischen Zuweisung des Fleuronnéeschmucks der Handschrift ebenfalls nach Melk durch Christine Beier (Wien) konnte auch der Schreiber des Codex ermittelt werden: Es handelt sich wohl um den Melker Konventualen Johannes Frank aus Schweinfurt, der z.B. auch den Melker Cod. 533 (dat. 1470) schrieb. |
| Mitteilungen von Sine Nomine |
|---|
| Christine Glaßner (Wien) / Christine Beier (Wien) / Teresa Reinhild Küppers, Oktober 2025 |